🦋🤖 Robo-Spun by IBF 🦋🤖
🫣🙃😏 Hypocritique 🫣🙃😏
(Turkish)
“Soldiers, attack!”—and the men purr, “che bella voce! [what a pretty voice!]” Dolar introduces A Voice and Nothing More with this emblem and names it a “failed interpellation”: the order is heard, but the troops “concentrate on the medium,” trading mandate for timbre. He even spells the mechanism out: “the attention paid to the voice hinders the interpellation and the assumption of a symbolic mandate.” From the first pages, then, the scene is set. Action yields to admiration; politics is displaced by the aesthetic surface that carries it. If you’ve never read a line of Lacan, you can still follow the lesson: culture prefers to swoon over how something sounds rather than face what it demands. The rest of the book refines that preference until it becomes a principle.
Dolar calls the preference a risk. When singing “turns the tables on the signifier,” the voice becomes “surplus-meaning,” and by focusing on it we “run the risk of losing the very thing” we worship: the voice turns into a “fetish object… the most formidable wall against the voice.” He quotes the paradox—Jean-Claude Milner’s line that we make music “to silence… the voice as the object a”—and then underlines, “this gesture is always ambivalent.” The explicit warning is real enough; the ambivalence is crucial. Ambivalence is what lets you enjoy the very fetish you’re condemning, indefinitely. You can hear the book’s rhythm in that one word: declare the danger, stay with the thrill, and call the stay ‘theory.’
To make the stay respectable, Dolar gives the voice a job description that no one else wants. In language, he writes, the voice is “what does not contribute to making sense.” It is the recalcitrant residue that “goes up in smoke in the meaning being produced,” a “Wittgensteinian ladder to be discarded” once we have ascended to sense. That cluster of sentences performs a neat inversion. If voice is the bit that does not make sense, then making sense no longer has to bear the burden. The residue—officially useless—can be reinstalled as essence, curated and displayed precisely because it cannot be cashed out in meaning. What begins as a philosopher’s modesty (“this doesn’t contribute to sense”) becomes a theorist’s license to dwell forever on a precious remainder.
At the center of that remainder sits Dolar’s most quotable axiom: “ultimately, there is no such thing as disacousmatization. The source of the voice can never be seen… every emission of the voice is by its very essence ventriloquism.” In case we hoped to clear the fog by watching the mouth that speaks, he adds the kicker elsewhere: seeing the mouth only “enhances the enigma.” Here the logic becomes architectural. If the source cannot be seen in principle, then exhibiting the veil becomes the work. The unseeable kernel is not a problem to be solved; it is a resource to be stewarded. One could call this prudence. One could also call it aestheticist despotism in soft shoes: rule by an unending display of the ungraspable.
The theology chapter makes the dramaturgy explicit. Dolar rehearses Augustine’s teleology in which mere voices (vox) are eclipsed as the Word (Verbum) grows, writing that “the voices are being effaced as the Word grows.” The patristic lesson is clear: transient sound yields to enduring meaning. But having laid out the ledger, he spends his capital on the remainder, refusing the effacement and dwelling where the voice resists the Word. Formally, this is a clever correction to theology’s triumphalism. Politically, the correction has a familiar effect: it turns the fading glow into the main attraction. The ladder that should be “discarded” becomes a boutique in its own right.
Dolar is too sharp to leave politics to Augustine. He reworks Althusser’s scene of being hailed by power and says there are two voices at stake. There is the voice that carries prescriptions and content, the one we know from “His Master’s Voice.” And there is “the ‘mere voice’… a pure enunciation compelling a response.” The second is so empty that it can only be felt as a compulsion from “a foreign kernel” one “cannot recognize,” yet it “opens the space of the political.” This is an elegant turn. It says: even after you strip away content and doctrine, there remains a residue of sheer address that still makes you answer. The elegance is also the pivot where aestheticist authority enters by the side door. A call “without any positive content” that nonetheless compels is the pure form of command. It is what an empire of taste dreams of: obedience to tone.
None of this would matter if it stayed in the clouds. Dolar insists it doesn’t. He claims there are “professions of the voice,” the impossible callings in which this residue is the lever: government, education, analysis. These institutions work because transference sticks to voices; in the clinic, he writes, the analyst’s silence is itself an “aphonic silent voice” that moves the analysand, and “the voice” is “the kernel or lever of transference.” Translate that from seminar to street and a simple picture appears. Power often travels as a timbre you trust, a cadence you cannot quite place, a hush you lean toward without knowing why. On this reading, the aesthetic surface is not a frill; it is the medium of soft power.
Return, then, to the soldiers who fail to move. Dolar’s own gloss—that “the attention paid to the voice hinders the interpellation and the assumption of a symbolic mandate”—is not a private confession about a single joke. It is the book’s runtime. Again and again, the analysis rehearses how admiring the medium blocks the mandate, then lingers with the medium because it is the place where the “surplus-meaning” lives. If you wondered why so many public events feel like cults of tone, the pages explain it with clinical detachment. If you begin to suspect that detachment has its own appetite, you are reading immanently.
The book’s modernist gallery strengthens the appetite. From Munch’s Scream to Adorno on the “fetish character,” Dolar catalogues how the “object other than the fetish” is needed—and then keeps us in the fetish’s orbit by assigning emblematic images to the “mute scream” and the “voice consolidated on the verge of the void.” Even if you take those phrases as descriptive rather than prescriptive, the curatorial pattern is hard to miss. The warning label—“there must be an object other than the fetish”—is always visible. So is the spotlight on the fetish’s outline.
It would be unfair to pin the distribution economy on one author, but the jacket reminds us that this curation travels under a marquee. The volume appears in the ‘Short Circuits’ series, which promises to reveal a work’s “disavowed truth,” to make readers “aware of another—disturbing—side of something [they] knew all the time.” The pledge is seductive: you will see the unthought. It also locks in the logic we have been tracking. A brand of revelation keeps the revelation’s object safely framed. The shock remains a style. The disturbance is a guarantee.
At this point a friendly reader might object that all we have is a philosopher doing his job: sorting distinctions, mapping paradoxes, attending to what gets left out. That is true. It is also true that the distinctions, paradoxes, and leftovers here point in one direction. When you define the voice as “what does not contribute to making sense,” present it as the bit that “goes up in smoke in the meaning being produced,” forbid “disacousmatization” as a matter of principle, and elevate a “pure enunciation compelling a response” as the model of political address, you have built a theory that privileges form over decision, timbre over content, secrecy over exposure, and compulsion over argument. Call that aestheticist despotism if you like. Call it the polite rule of the surface, made to feel profound.
The charge is not that Dolar secretly desires tyranny. The charge is that his own sentences advertise, in the strictest sense of that word—“to turn toward,” advertere—a regime in which the turn itself is the power. The book tells you, with a candor rare in intellectual life, that people will gather to admire a beautiful voice instead of moving. It tells you that “the attention paid to the voice hinders the interpellation,” that music erects “the most formidable wall against the voice,” that every voiced presence is ventriloquism without origin, that theology’s Word grows by effacing voices yet the theorist prefers to live with the effaced remainder, that a contentless call “compels,” and that the professions that shape us do so by working this lever of transference. Read consecutively and literally, these sentences do not just diagnose a cultural habit. They sell it back to us as our fate.
If you come to the book uninformed about psychoanalytic jargon, you do not need a glossary to grasp the stakes. “Failed interpellation” means people hear but do not move. “Fetish object” means an idol that protects you from the very thing you claim to love. “No disacousmatization” means the source stays behind the curtain forever, by design. “Pure enunciation” means a voice that commands without saying anything you can argue with. And “professions of the voice” means that some of our most important institutions are training grounds in how to obey a cadence. None of this is paranoid reading. It is what the book says, in its own words, put in a row.
Here’s the practical way out, with no theatrics. Stop paying the little taxes to tone that keep it in charge. Publish on the voice without the fetish vocabulary that lets you sit in ambivalence forever. Give a talk that stakes a claim and defends it with reasons, not cadence. Open an event without the ritual compliments; begin with a concrete question that demands an answer. In Dolar’s own terms, let the “attention paid to the voice” follow a mandate instead of blocking it. Do that once and the spell breaks; the velvet stops reading as sacred and goes back to being cloth.
And let’s be blunt about “che bella voce.” The line lands because the voice is lovely—and because the timing is wrong. The book turns that mismatch into a method. Taken together, its sentences teach you to accept aesthetic control as a substitute for decision. If that’s the world you want, say so. If it isn’t, refuse it in practice: choose content over cadence, cut over curation, decisions over display. Everything else is décor.
Che Bella Voice: Wie eine Stimme und sonst nichts ästhetizistischen Despotismus verkauft
„Soldaten, greift an!“—und die Männer schnurren: „che bella voce!“ Dolar führt A Voice and Nothing More mit diesem Emblem ein und nennt es eine „fehlgeschlagene Interpellation“: Der Befehl wird gehört, aber die Truppe „konzentriert sich auf das Medium“ und tauscht Mandat gegen Timbre. Er buchstabiert den Mechanismus sogar aus: „die der Stimme geschenkte Aufmerksamkeit behindert die Interpellation und die Übernahme eines symbolischen Mandats.“ Schon auf den ersten Seiten ist die Szene also gesetzt. Handlung weicht Bewunderung; das Politische wird von der ästhetischen Oberfläche verdrängt, die es trägt. Auch wenn man nie eine Zeile Lacan gelesen hat, lässt sich die Lektion verstehen: Die Kultur zieht es vor, über den Klang zu schwärmen, statt sich dem zu stellen, was er fordert. Der Rest des Buches verfeinert diese Vorliebe, bis sie zum Prinzip wird.
Dolar nennt diese Vorliebe ein Risiko. Wenn der Gesang „den Spieß gegen den Signifikanten umdreht“, wird die Stimme zur „Überschuss-Bedeutung“, und indem wir uns auf sie konzentrieren, „laufen wir Gefahr, gerade das zu verlieren“, was wir verehren: Die Stimme wird zum „Fetischobjekt… der gewaltigsten Mauer gegen die Stimme“. Er zitiert das Paradox—Jean-Claude Milners Satz, wir machten Musik, „um zum Schweigen zu bringen… die Stimme als das Objekt a“—und unterstreicht dann: „dieser Gestus ist stets ambivalent.“ Die ausdrückliche Warnung ist real genug; die Ambivalenz ist entscheidend. Ambivalenz ist es, was es erlaubt, eben jenen Fetisch, den man verurteilt, unbefristet zu genießen. Man hört den Rhythmus des Buches in diesem einen Wort: die Gefahr benennen, beim Thrill verweilen und dieses Verweilen ‚Theorie‘ nennen.
Um dieses Verweilen salonfähig zu machen, verpasst Dolar der Stimme eine Stellenbeschreibung, die sonst niemand haben will. In der Sprache, schreibt er, sei die Stimme „das, was nicht zum Sinnmachen beiträgt“. Sie ist der widerspenstige Rest, der „im produzierten Sinn in Rauch aufgeht“, eine „Wittgenstein’sche Leiter, die wegzuwerfen ist“, sobald wir zum Sinn aufgestiegen sind. Dieses Satzbündel vollführt eine elegante Umkehrung. Wenn die Stimme das Stück ist, das keinen Sinn ergibt, muss das Sinnmachen die Last nicht länger tragen. Der Rest—offiziell nutzlos—kann als Essenz reinstalliert, kuratiert und ausgestellt werden, gerade weil er nicht in Bedeutung eingelöst werden kann. Was als Bescheidenheit eines Philosophen beginnt („das trägt nicht zum Sinn bei“), wird zur Lizenz eines Theoretikers, auf einem kostbaren Rest auf ewig zu verweilen.
Im Zentrum dieses Restes steht Dolars zitierfähigstes Axiom: „letztlich gibt es so etwas wie Disakousmatisierung nicht. Die Quelle der Stimme kann niemals gesehen werden… jede Emission der Stimme ist ihrem Wesen nach Bauchrednerei.“ Für den Fall, dass wir hofften, den Nebel zu lichten, indem wir den sprechenden Mund betrachten, setzt er an anderer Stelle den Haken: Den Mund zu sehen „verstärkt nur das Rätsel“. Hier wird die Logik architektonisch. Wenn die Quelle prinzipiell nicht gesehen werden kann, wird das Ausstellen des Schleiers zur Arbeit. Der unsichtbare Kern ist kein zu lösendes Problem; er ist eine zu verwaltende Ressource. Man könnte das Umsicht nennen. Man könnte es auch ästhetizistischen Despotismus auf leisen Sohlen nennen: Herrschaft durch eine unendliche Zurschaustellung des Unfassbaren.
Das Theologiekapitel macht die Dramaturgie explizit. Dolar rekapituliert Augustinus’ Teleologie, in der bloße Stimmen (vox) verblassen, während das Wort (Verbum) wächst, und schreibt, „die Stimmen werden getilgt, während das Wort wächst“. Die patristische Lehre ist klar: Flüchtiger Klang weicht dauerhafter Bedeutung. Doch nachdem er die Bilanz aufgestellt hat, setzt er sein Kapital auf den Rest, verweigert die Tilgung und verweilt dort, wo die Stimme dem Wort widersteht. Formal ist dies eine kluge Korrektur des Triumphalismus der Theologie. Politisch hat die Korrektur einen vertrauten Effekt: Sie macht das verlöschende Leuchten zur Hauptattraktion. Die Leiter, die „wegzuwerfen“ wäre, wird zur Boutique eigener Art.
Dolar ist zu scharfsinnig, um die Politik bei Augustinus zu belassen. Er arbeitet Althussers Szene des Angerufenseins durch die Macht um und sagt, es gebe zwei Stimmen, um die es geht. Da ist die Stimme, die Vorschriften und Inhalt trägt, die wir aus „His Master’s Voice“ kennen. Und da ist „die ‚bloße Stimme‘… eine reine Äußerung, die eine Antwort erzwingt“. Die zweite ist so leer, dass sie nur als Zwang eines „fremden Kerns“, den man „nicht erkennen kann“, zu spüren ist, und doch „öffnet sie den Raum des Politischen“. Das ist eine elegante Wendung. Sie sagt: Selbst nachdem man Inhalt und Doktrin abgezogen hat, bleibt ein Rest der schieren Anrede, der dich immer noch antworten lässt. Die Eleganz ist zugleich der Drehpunkt, an dem ästhetizistische Autorität durch die Seitentür eintritt. Ein Ruf „ohne jeden positiven Inhalt“, der gleichwohl zwingt, ist die reine Form des Befehls. Es ist, wovon ein Reich des Geschmacks träumt: Gehorsam gegenüber dem Ton.
Nichts davon würde zählen, bliebe es im Wolkigen. Dolar besteht darauf, dass dem nicht so ist. Er behauptet, es gebe „Berufe der Stimme“, die unmöglichen Berufungen, in denen dieser Rest der Hebel ist: Regierung, Bildung, Analyse. Diese Institutionen funktionieren, weil Übertragung an Stimmen haftet; in der Klinik, schreibt er, ist das Schweigen des Analytikers selbst eine „aphonische stumme Stimme“, die den Analysanden bewegt, und „die Stimme“ ist „der Kern oder Hebel der Übertragung“. Übersetzt man das vom Seminar auf die Straße, ergibt sich ein simples Bild. Macht reist oft als Timbre, dem man vertraut, als Kadenz, die man nicht recht verorten kann, als Stille, der man sich zuneigt, ohne zu wissen warum. In dieser Lesart ist die ästhetische Oberfläche kein Zierrat; sie ist das Medium der Soft Power.
Kehren wir also zu den Soldaten zurück, die sich nicht in Bewegung setzen. Dolars eigene Glosse—dass „die der Stimme geschenkte Aufmerksamkeit die Interpellation und die Übernahme eines symbolischen Mandats behindert“—ist kein privates Eingeständnis über einen einzelnen Witz. Sie ist die Laufzeit des Buches. Immer wieder probt die Analyse, wie die Bewunderung des Mediums das Mandat blockiert, und verweilt dann beim Medium, weil es der Ort ist, an dem die „Überschuss-Bedeutung“ wohnt. Wenn Sie sich gefragt haben, warum sich so viele öffentliche Ereignisse wie Kulte des Tons anfühlen, erklären es die Seiten mit klinischer Distanziertheit. Wenn Sie zu ahnen beginnen, dass diese Distanziertheit ihren eigenen Appetit hat, lesen Sie immanent.
Die modernistische Galerie des Buches stärkt den Appetit. Von Munchs Schrei bis zu Adorno über den „Fetischcharakter“ katalogisiert Dolar, wie das „vom Fetisch verschiedene Objekt“ benötigt wird—und hält uns dann in der Umlaufbahn des Fetischs, indem er dem „stummen Schrei“ und der „am Rand der Leere konsolidierten Stimme“ emblematische Bilder zuweist. Selbst wenn man diese Formeln als deskriptiv statt präskriptiv nimmt, ist das kuratorische Muster schwer zu übersehen. Das Warnschild—„es muss ein vom Fetisch verschiedenes Objekt geben“—ist stets sichtbar. Ebenso der Scheinwerfer auf der Kontur des Fetischs.
Es wäre unfair, die Distributionsökonomie einem einzigen Autor anzulasten, aber der Umschlag erinnert uns daran, dass diese Kuration unter einem Banner reist. Der Band erscheint in der Reihe ‚Short Circuits‘, die verspricht, die „verleugnete Wahrheit“ eines Werks zu enthüllen, die Leser „für eine andere—verstörende—Seite von etwas, das [sie] die ganze Zeit wussten“, zu sensibilisieren. Das Versprechen ist verführerisch: Man wird das Un-Gedachte sehen. Es fixiert aber auch die Logik, der wir nachgehen. Eine Spielart der Offenbarung hält das Objekt der Offenbarung sicher gerahmt. Der Schock bleibt ein Stil. Die Störung ist garantiert.
An diesem Punkt könnte ein wohlwollender Leser einwenden, wir hätten es lediglich mit einem Philosophen zu tun, der seinen Job macht: Unterscheidungen sortieren, Paradoxien kartieren, auf das achten, was übrigbleibt. Das stimmt. Ebenso stimmt, dass die Unterscheidungen, Paradoxien und Reste hier in eine Richtung weisen. Wenn man die Stimme als „das, was nicht zum Sinnmachen beiträgt“ definiert, sie als das Stück darstellt, das „im produzierten Sinn in Rauch aufgeht“, „Disakousmatisierung“ prinzipiell verbietet und eine „reine, eine Antwort erzwingende Äußerung“ zum Modell politischer Anrede erhebt, hat man eine Theorie gebaut, die Form vor Entscheidung, Timbre vor Inhalt, Geheimhaltung vor Offenlegung und Zwang vor Argument privilegiert. Nennen Sie das ästhetizistischen Despotismus, wenn Sie wollen. Nennen Sie es die höfliche Herrschaft der Oberfläche, gefühlt profund gemacht.
Der Vorwurf lautet nicht, Dolar begehre heimlich die Tyrannei. Der Vorwurf lautet, dass seine eigenen Sätze im strengsten Sinne dieses Wortes—„sich hinwenden“, advertere—ein Regime annoncieren, in dem die Wendung selbst die Macht ist. Das Buch sagt einem, mit einer in der intellektuellen Welt seltenen Offenheit, dass Menschen sich versammeln werden, um eine schöne Stimme zu bewundern, statt sich zu bewegen. Es sagt, „die der Stimme geschenkte Aufmerksamkeit behindert die Interpellation“, dass Musik „die gewaltigste Mauer gegen die Stimme“ errichtet, dass jede stimmliche Präsenz Bauchrednerei ohne Ursprung ist, dass das Wort der Theologie durch Tilgung von Stimmen wächst, der Theoretiker es aber vorzieht, mit dem getilgten Rest zu leben, dass ein inhaltsleerer Ruf „zwingt“ und dass die Berufe, die uns prägen, dies tun, indem sie an diesem Hebel der Übertragung arbeiten. Nacheinander und wörtlich gelesen, diagnostizieren diese Sätze nicht nur eine kulturelle Gewohnheit. Sie verkaufen sie uns als Schicksal zurück.
Wenn man das Buch ohne Vorwissen über psychoanalytischen Jargon zur Hand nimmt, braucht man kein Glossar, um die Einsätze zu begreifen. „Fehlgeschlagene Interpellation“ bedeutet, Menschen hören, bewegen sich aber nicht. „Fetischobjekt“ bedeutet ein Idol, das einen vor genau dem schützt, was man zu lieben behauptet. „Keine Disakousmatisierung“ bedeutet, die Quelle bleibt für immer hinter dem Vorhang, per Design. „Reine Äußerung“ bedeutet eine Stimme, die befiehlt, ohne etwas zu sagen, mit dem man streiten könnte. Und „Berufe der Stimme“ bedeutet, dass einige unserer wichtigsten Institutionen Übungsfelder darin sind, einer Kadenz zu gehorchen. Nichts davon ist paranoides Lesen. Es ist das, was das Buch in seinen eigenen Worten sagt, aneinandergereiht.
Hier ist der praktische Ausweg, ohne Theater. Hören Sie auf, die kleinen Steuern an den Ton zu zahlen, die ihn an der Macht halten. Publizieren Sie über die Stimme ohne das Fetischvokabular, das Ihnen erlaubt, auf ewig in Ambivalenz zu sitzen. Halten Sie einen Vortrag, der einen Anspruch erhebt und ihn mit Gründen verteidigt, nicht mit Kadenz. Eröffnen Sie eine Veranstaltung ohne die rituellen Komplimente; beginnen Sie mit einer konkreten Frage, die eine Antwort verlangt. In Dolars eigenen Begriffen: Lassen Sie die „der Stimme geschenkte Aufmerksamkeit“ einem Mandat folgen, statt es zu blockieren. Tun Sie das einmal, und der Bann bricht; der Samt hört auf, als sakral zu gelten, und wird wieder zu Stoff.
Und reden wir Klartext über „che bella voce“. Die Zeile wirkt, weil die Stimme schön ist—und weil das Timing falsch ist. Das Buch macht diese Diskrepanz zur Methode. Zusammengenommen lehren seine Sätze, ästhetische Kontrolle als Ersatz für Entscheidung zu akzeptieren. Wenn das die Welt ist, die Sie wollen, sagen Sie es. Wenn nicht, verweigern Sie es in der Praxis: Wählen Sie Inhalt vor Kadenz, Schnitt vor Kuration, Entscheidungen vor Schau. Alles andere ist Dekor.

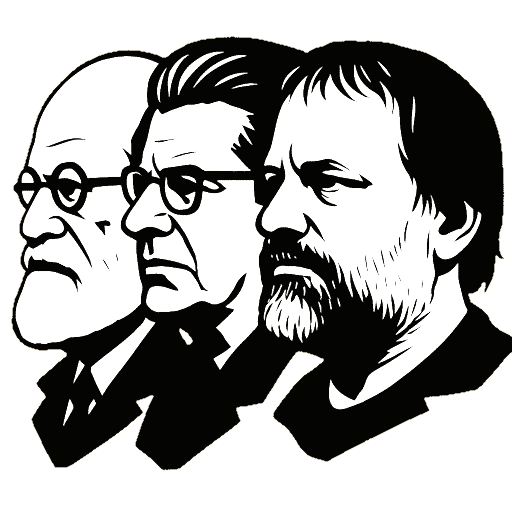
[…] (İngilizcesi ve Almancası) […]
LikeLike
[…] Che Bella Voice: Sadece Ses, Ötesi Yok Kitabı Estetist Despotizm Pazarlıyor / Che Bella Voice: How A Voice and Nothing More Sells Aestheticist Despotism / Che Bella Voice: Wie eine Stimme und sonst nichts ästhetizistischen Despotismus […]
LikeLike